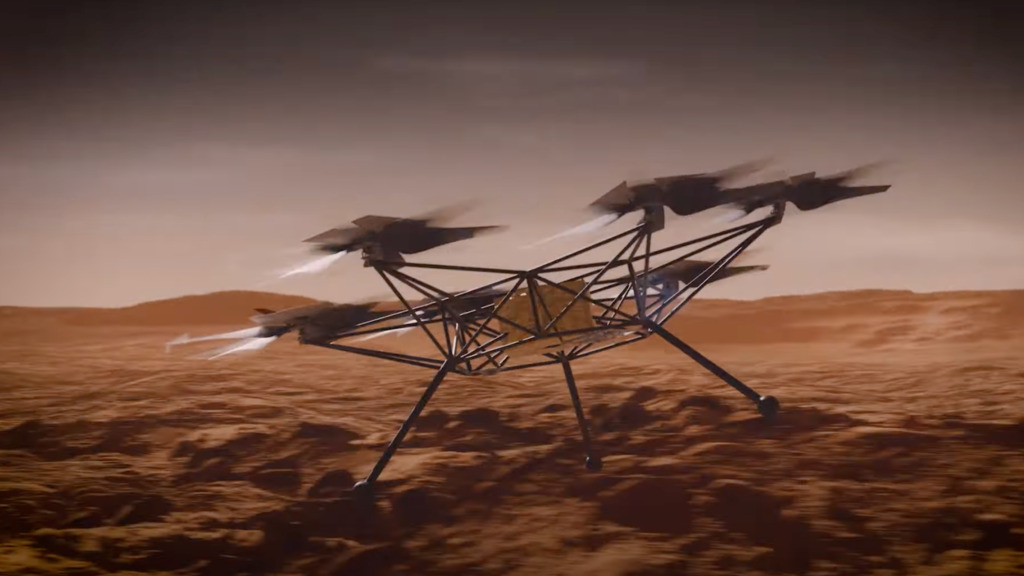Übersicht
Live Fussball
Ligen
Übersicht
Live Wintersport
Resultate und Wertungen FIS
Resultate und Wertungen IBU
Übersicht
Live Eishockey
Resultate und Tabelle
Übersicht
Live Tennis
Turniere
Resultate
Übersicht
Live Motorsport
Rennen und Wertungen
Dienste
blue news – social media
Swisscom
- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Spionage-Affäre Chiffriermaschine war gestern: Wie Geheimdienste im Netz schnüffeln
Von Dirk Jacquemien
12.2.2020

Die nun aufgedeckte «Operation Rubikon» hat sich vor allem im analogen Zeitalter abgespielt. Doch heutzutage haben Staaten noch mehr Möglichkeiten zur Spionage.
Die Spionage-Affäre um die Zuger Firma Crypto AG zieht derzeit weite Kreise, obwohl die Ereignisse grösstenteils schon lange Jahre zurückliegen. Spezialisierte Chiffriergeräte, wie sie von der Crypto AG fabriziert wurden, kommen heute fast nicht mehr zum Einsatz, stattdessen wird Software zur Verschlüsselung verwendet.
Sicherlich setzen Geheimdienste auch weiterhin auf ganz traditionelle Spionagemethode, wie das Platzieren von Wanzen an sensiblen Orten. Jüngst soll so etwa der türkische Geheimdienst die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul aufgenommen haben.
Doch ein Grossteil der Spionage findet heute durch die Überwachung der Kommunikation im Internet statt, wie spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden bekannt sein sollte. Welche Möglichkeiten Geheimdienste da haben, zeigen wir folgend.
Anzapfung direkt an der Quelle
Diese Option steht quasi jedem Staat zur Verfügung: Man fängt den Datenverkehr einfach an Orten ab, die unter eigener Kontrolle stehen. Das können Internetknoten-Punkte oder Netzanbieter ein. In vielen Ländern gibt es entsprechende Gesetze, die Unternehmen zur heimlichen Kooperation mit den Behörden verpflichten — die Spionage ist also zumindest nach örtlichen Gesetzen völlig legal.

Im Vorteil sind hier natürlich Geheimdienste, die sich in Ländern befinden, durch die besonders viel internationaler Internet-Verkehr verläuft, etwa die USA oder Deutschland. Am weltgrössten Internet-Knoten in Frankfurt am Main ist etwa der deutsche Bundesnachrichtendienst aktiv. Der Betreiber DE-CIX wehrte sich vor Gericht erfolglos gegen die Verpflichtung, mit dem BND zusammen arbeiten zu müssen.
Diese sehr komfortable Möglichkeit der Spionage dürfte auch einer der Gründe sein, warum Russland kürzlich gesetzlich festgeschrieben hat, dass jeglicher Internet-Verkehr im Lande über vom Staat kontrollierte Server laufen muss.
Hier können sich Nutzer oder andere Staaten aber schützen, indem sie ihre Daten nur verschlüsselt auf die Reise schicken. Heutzutage gibt es frei verfügbare, quelloffene Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechniken, die allen Anzeichen nach bei richtiger Anwendung von keinem Staat geknackt werden können.
Zugriff auf gespeicherte Daten
Ging es im vorherigen Abschnitt um Zugriff auf «data in transit», ist auch «data at rest», also Daten, die irgendwo gespeichert sind, vielfach dem Zugriff von Geheimdiensten ausgesetzt. Hiervon betroffen sind etwa E-Mail-Anbieter oder Social-Media-Plattformen.
In autoritären Staaten reicht hier ein Anruf bei der entsprechenden Firma, in Demokratien ist meistens ein Gerichtsbeschluss nötig, um Zugriff zu erlangen. Dann können allerdings alle dort gespeicherten Daten abgerufen werden, und das oft, ohne dass Betroffene dies bemerken. Aufgrund der Dominanz amerikanischer Tech-Unternehmen liegt hier der Vorteil klar bei den US-Geheimdiensten, da natürlich auch zahlreiche Nicht-Amerikaner die Dienste von Google, Amazon, Apple, Facebook und Co. in Anspruch nehmen. Bei dort gespeicherten Daten muss man damit rechnen, dass sie jederzeit CIA und NSA zur Verfügung stehen.
«Data at rest» auf Fremd-Servern vor dem Zugriff von Geheimdiensten zu schützen, ist oft unmöglich. Nur einige wenige, spezialisierte E-Mail- und Cloud-Dienste bieten die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für gespeicherte Daten an, in den allermeisten Fällen hat ein Anbieter auch die Möglichkeit zur Entschlüsselung und damit zur Weitergabe an Geheimdienste.
Ausbeutung von unbekannten Schwachstellen
Natürlich sind Geheimdienste weltweit fleissig am Hacken, um an sensible Informationen von geopolitischen Rivalen oder inneren Dissidenten zu kommen. Besonders perfide wird es aber, wenn sie dabei Sicherheitslücken ausnutzen, die öffentlich nicht bekannt sind und für die es dementsprechend kein Update gibt, das sie schliesst. China etwa nutzte eine lange unentdeckte iOS-Sicherheitslücke, um die Uiguren auszuspionieren.
Vor allem die NSA war jedoch berühmt-berüchtigt dafür, Schwachstellen beispielsweise bei Windows nicht etwa an Microsoft zu melden, sondern sie so lange wie möglich für die eigenen Zwecke auszunutzen. Das wurde dem Geheimdienst zum Verhängnis, als die Gruppe «Shadow Brokers» in 2016 zahlreiche interne NAS-Hacking-Tools veröffentliche, die Windows-Sicherheitslücken ausnutzen. Inzwischen scheint die NSA ihr Vorgehen daher etwas überdacht zu haben. Im Januar wurde bekannt, dass der Geheimdienst nun Microsoft über eine von ihm entdeckte Schwachstelle bei Windows informierte.
Einsatz von Hacking-Software von Privatunternehmen
Vor allem Staaten mit wenig eigener technischer Expertise kaufen sich gerne Spionage-Software von Privatunternehmen. Hier hat sich in den letzten Jahren eine richtige Industrie entwickelt, mit Firmen wie der israelischen NSO Group oder dem italienischen Hacking Team. Diese verkaufen ihre Software gerne an Staaten mit wenig Achtung für die Menschenrechte.
Wenn diese die Software dann, wie zu erwarten war, dazu einsetzen, um die eigene Bevölkerung oder Journalisten auszuspionieren, tun die Unternehmen dann plötzlich sehr empört. Eine Untersuchung von «Citizen Lab» zeigte etwa auf, dass die NSO Group-Software Pegasus von Saudi-Arabien zur Ausspionierung eines «New York Times»-Journalisten sowie von Bekannten von Khashoggi eingesetzt wurde. Facebook hat Ende letztes Jahres Klage gegen die NSO Group eingereicht, weil sie WhatsApp-Schwachstellen ausgenutzt haben soll.
Einbau von Backdoors in vermeintlich legitimer Software
Relativ neu und besonders raffiniert ist die Erstellung und Verbreitung von vermeintlich legitimen Apps, deren eigentlicher Zweck allerdings die Spionage ist. Hier wurde erst im Dezember ein konkretes Beispiel bekannt. Die Chat-App ToTok aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde offenbar einzig zu Spionagezwecken erstellt.
Der Plan lief wie folgt ab. Zunächst wurden fast alle anderen Videochat-Apps wie Skype in den Emiraten blockiert. Einzig eine kostenpflichtige App funktionierte. Plötzlich wurde mit einer grossen Werbekampagne ToTok mit gratis Videoanrufen in die ganze Welt und vielen anderen Features vorgestellt. Naturgemäss wurde die App schnell populär. Erst durch einen Bericht der «New York Times» wurde dann bekannt, dass ToTok höchstwahrscheinlich im Auftrag des emiratischen Geheimdienstes kreiert wurde, um möglichst viel Kommunikation im Land abfangen zu können.
Bilder des Tages

Evakuierungsaktion bei der Seilbahn Lungern-Turren in Lungern im Kanton Obwalden: Wegen einer technischen Panne mussten rund 27 Personen mit dem Helikopter gerettet werden.
Bild: KEYSTONE

Zu zweit durch dick und dünn – und durch heiss und eiskalt: Dieses Liebespaar sprang am Valentinstag in Hamburg ins kalte Wasser.
Bild: Georg Wendt/dpa

Fasnächtliche und farbenfrohe Puppen zieren das Dorf Seelisberg im Kanton Uri über die Fasnachtstage. Die Fasnacht 2021 ist im Kanton Uri aufgrund der Corona-Ppandemie praktisch verboten, es duerfen maximal nur 5 Personen unterwegs sein, aber als einer der wenigen Kantone ist in Uri das Spielen von Musikinstrumenten erlaubt. (13.02.2021)
Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler

Die Pandabären-Geschwister Paule (r) und Pit (l) spielen in ihrem Gehege im Zoo Berlin im Schnee. (13.02.2021)
Bild: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Halb Euroopa friert. Diese Heidschnucken in Braunschweig jedoch lassen sich von den frostigen Temperaturen nicht beeindrucken. (13.02.2021)
Bild: Stefan Jaitner/dpa

Sahara-Sand färbt Schnee und Himmel orange im Skigebiet Anzère in der Schweiz.
Bild: Keystone/Laurent Gillieron

Menschen drängen sich in der Einkaufsstrasse Via del Corso in Rom nachdem die Corona-Massnahmen gelockert wurden.
Bild: Cecilia Fabiano/dpa

Irgendwo dort versteckt sich die A7: Nahe Hannover herrscht dichtes Schneetreiben auf der Autobahn.
Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Replik der Saffa-Schnecke fotografiert vor der Schweizer Nationalbank während einer Jubiläumsaktion organisiert von Bern Welcome, zu 50 Jahren Frauenstimm- und -wahlrecht. (06.02.2021)
Bild: Anthony Anex/Keystone

Ein Porträt von Elisabeth Vischer-Alioth wartet darauf, an eine Hauswand geklebt zu werden, während der Vorbereitungen zur Ausstellung «Hommage 2021: Porträts von mutigen Frauen in der Berner Altstadt». (06.02.2021)
Bild: Anthony Anex/Keystone

Abgeschirmte Speisekuppel. So geht es auch. Im israelischen Jerusalem speisen Restaurantbesucher abgeschirmt von anderen Gästen in einer Kuppel. Israel plant trotz anhaltend hoher Infektionszahlen erste Lockerungen einleiten. (06.02.2021)
Bild: Muammar Awad/XinHua/dpa

Ein überfluteter Platz beim Flussufer in Saint-Ursanne. Der Fluss Doubs trat nach starken Regenfällen über die Ufer. (31.1.2021)
Bild: Keystone

Während einer Demonstration gegen die Inhaftierung von Kremlkritiker Nawalny führen russische Polizisten einen Mann ab. (31.1.2021)
Bild: Aleksander Khitrov/AP/dpa

Imposante Kulisse: In Los Angeles können sich die Menschen unter anderem auf dem Parkplatz des Dodger Stadium gegen Corona impfen lassen. (31.1.2021)
Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa

Mehr als zwei Kilometer durch den eiskalten Bodensee: Der Extremschwimmer Paul Bieber hat mit seinem Versuch den deutschen Rekord im Distanz-Eisschwimmen gebrochen. Der 37-Jährige schwamm bei unter fünf Grad Wassertemperatur 2210 Meter weit. 43,03 Minuten brauchte er dafür. (30.1.2021)
Bild: Felix Kästle/dpa

Gleich zwei Mal binnen 48 Stunden gab es in Raron im Kanton Wallis infolge der Schlechtwettersituation in den letzten Tagen Felsstürze. (30.1.2021)
Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron

Vor einem pittoresken Wolkenhimmel zeigt Max Ross auf einer Slackline im Hillcrest Park im kalifornischen Fullerton sein Können. (30.1.2021)
Bild: Mark Rightmire/The Orange County Register/dpa

Ein internationales Forscherteam hat auf Madagaskar eine neue Chamäleonart entdeckt, bei der das Männchen lediglich 13,5 Millimeter lang ist. Obwohl das männliche Tier das kleinste unter rund 11‘050 Reptilienarten ist, verfügt es in Relation zur Körpergrösse über die die grössten Genitalien. Der Grund: Eine erfolgreiche Paarung mit den bedeutend grösseren Weibchen wäre sonst nicht möglich. (28.1.2021)
Bild: Frank Glaw/SNSB-ZSM/dpa

Und dann hatte Hamburg eine Mülldeponie mehr: Im Stadtteil Norderstedt der Hansestadt türmt sich in einem Gewerbegebiet bis zu sechs Meter Müll wie Bauschutt, Teerpappe, Dämmstoffe, Asbest und anderes. Der Unternehmer, der dort bestimmte Stoffe nur zwischenlagern durfte, ist verschwunden. Die Staatsanwaltschaft sucht nun nach ihm. (27.1.2021)
Bild: Christian Charisius/dpa

«Minor Canyon»: Schwere Regenfälle haben im kalifornischen Monterey County zu Schlammlawinen, Überschwemmungen und zu dieser beeindruckenden Mini-Schlucht geführt. (28.1.2021)
Bild: Noah Berger/AP/dpa

Gedenken: Die New Yorker Verkehrsbetriebe ehren 136 Mitarbeiter, die am Coronavirus gestorben sind, mit einer digitalen Gedenkstätte an 107 U-Bahn-Stationen – wie hier in der Moynihan Train Hall im New Yorker Stadtteil Manhattan. (29.1.2021)
Bild: John Minchillo/AP/dpa

Schlange an der Notaufnahme: Rettungssanitäter warten vor dem Santa Maria Krankenhaus in Lissabon, um Covid-19-Patienten zu übergeben. Portugal gehört momentan zu den Ländern mit den weltweit höchsten Neuinfektionszahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl. (28.1.2021)
Bild: Armando Franca/AP/dpa

Feuer an der Tankstelle: Die deutsche Rastanlage Hunsrück Ost an der Autobahn A61 ist einer nur knapp einer Katastrophe entgangen, nachdem hier ein Kleintransporter beim Betanken in Vollbrand geriet. Erst die Feuerwehr konnte das Feuer löschen – zuvor hatte der Kassier allerdings richtig reagiert und per Notschalter die ganze Tankanlage ausser Betrieb genommen. (28.1.2021)
Bild: Keystone

Strand ohne Leben: Ein Bademeister arbeitet am leeren Strand von Palma auf Mallorca. Derzeit gibt es Corona-bedingt kaum Touristen auf der Ferieninsel. (28.1.2021)
Bild: Mar Granel Palou/dpa

Da kann man auch grosse Augen machen: Auf einer österreichischen Landstrasse ist eine Waldohreule mit einem Auto zusammengestossen. Der Vogel überstand den Crash mit dem Bruch eines Flügels und wird derzeit auf einer Greifvogelstation aufgepäppelt. (28.1.2021)
Bild: APA/Keystone

Phantompatienten: An der Universität Leipzig warten Dummys mit einem Metallkopf, in den künstliche Gebisse hineingeschraubt werden können, auf Zahnmedizinstudenten. (28.1.2021)
Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Winston hat das Coronavirus besiegt: Der Gorilla erholt sich im Zoo von San Diego nach einer umfangreichen medikamentösen Behandlung von einem schweren Verlauf seiner Corona-Infektion. Bei dem 48-jährigen Silberrücken Winston waren im Zuge der Infektion eine Lungenentzündung und Herzprobleme aufgetreten. Er wurde daraufhin mit einer Antikörper-Therapie, Herzmedikamenten und Antibiotika behandelt. (26.1.2021)
Bild: Ken Bohn/San Diego Zoo Global/dpa

Auf glühenden Kohlen: Ein Mann produziert im Gaza-Streifen beim dort grössten Produzenten Holzkohle. Als bestes und teuerstes Holz für diesen Zweck gilt das von Zitrusbäumen, aber auch das von Olivenbäumen wird gerne verwendet. (26.1.2021)
Bild: Keystone

Von Ruhe auf einer Parkbank kann hier nicht die Rede sein: Möwen und Tauben schwirren und fliegen um eine Frau in Tokio umher. (26.1.2021)
Bild: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Schnack beim Snack: Fischer Willy Rivas scherzt im peruanischen Lima mit einem Freund beim Essen in der Fischerbucht in Chorrillos. (26.1.2021)
Bild: Rodrigo Abd/AP/dpa

Banger Blick zum Horizont: Ein freiwilliger Helfer benutzt sein Walkie-Talkie, während er den Vulkan Mount Merapi während einer Eruption überwacht. Der Vulkan, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt, ist erneut ausgebrochen und spukte mehrere Stunden glühende Asche und Gestein. (27.1.2021)
Bild: Slamet Riyadi/AP/dpa

Stausee verkommt zu «fliessenden Müllhalde: Ein Mann geht an Tonnen von Müll vorbei, die am Fusse des Wasserkraftwerks am Potpecko-Stausee in Serbien schwimmen. Vor allem Plastikabfälle gelangen durch Nebenflüsse in den Stausee und sammeln sich hier an. Eine serbische Zeitung schrieb bereits von einer «fliessenden Müllhalde». (26.1.2021)
Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa

Dickschädeltest: Stirn an Stirn messen zwei Rinder im deutschen Naturschutzgebiet Boberger Niederung ihre Kräfte. (25.1.2021)
Bild: Daniel Bockwoldt/dpa

Nasskaltes Ende: Zwischen Frauenfeld und Matzingen ist eine 33-jährige Wagenlenkerin bei Glatteis von der Strasse abgekommen und im Murgkanal gelandet. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. (26.1.2021)
Bild: Kapo TG

Opfer der Zerstörungswut: Ein Mann räumt in einem Fast-Food-Restaurant in Rotterdam auf. Die Niederlande sind erneut von sogenannten Corona-Krawallen erfasst worden. Hunderte gewaltbereite Jugendliche hatten nach Polizeiangaben in mehreren Städten randaliert und dabei auch die Polizei angegriffen. (25.1.2021)
Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Auf den Hund gekommen: Vierbeiner der Indian Railway Protection Force zeigen anlässlich des indischen Nationalfeiertags ihre Kunststückchen.
Bild: KEYSTONE

Galionsfigur mit Kettensäge: Im ungarischen Szilvásvárad streckt sich ein Feuerwehrmann auf dem Dach eines Zugs, um einen Ast abzusägen, der unter der Schneelast heruntergebrochen ist und die Bahnstrecke blockiert. (25.1.2021)
Bild: Keystone

Und sie tun es immer noch: In Rio De Janeiro tummeln sich grosse Menschenmengen auf engem Raum am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro. Und das obwohl Brasilien nach wie vor sehr hohe Corona-Fallzahlen hat.
Bild: Bruna Prado/AP/dpa

Himmlische Hilfe: Feuerwehrfrau Tegan Rayner von der Belair Brigade CFS freut sich über den Regen, während sie nach Löscharbeiten der Buschbrände in Cherry Gardens in der Nähe von Adelaide, Australien, steht. (25.1.2021)
Bild: Brenton Edwards/ADELAIDE ADVERTISER/AAP/dpa

Winterfest: Stammrosen sind im Rosenpark Dräger in Steinfurth, Deutschland, mit Folie kältesicher verpackt. (25.1.2021)
Bild: KEYSTONE