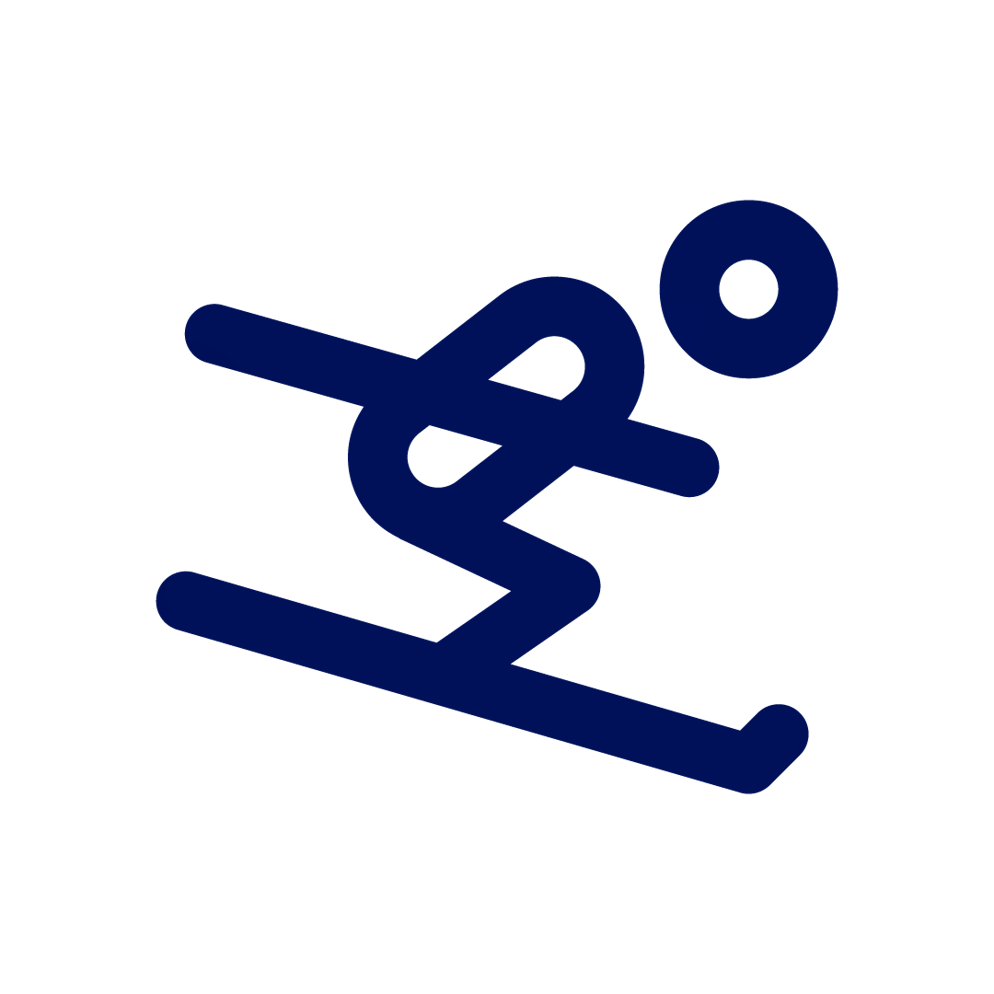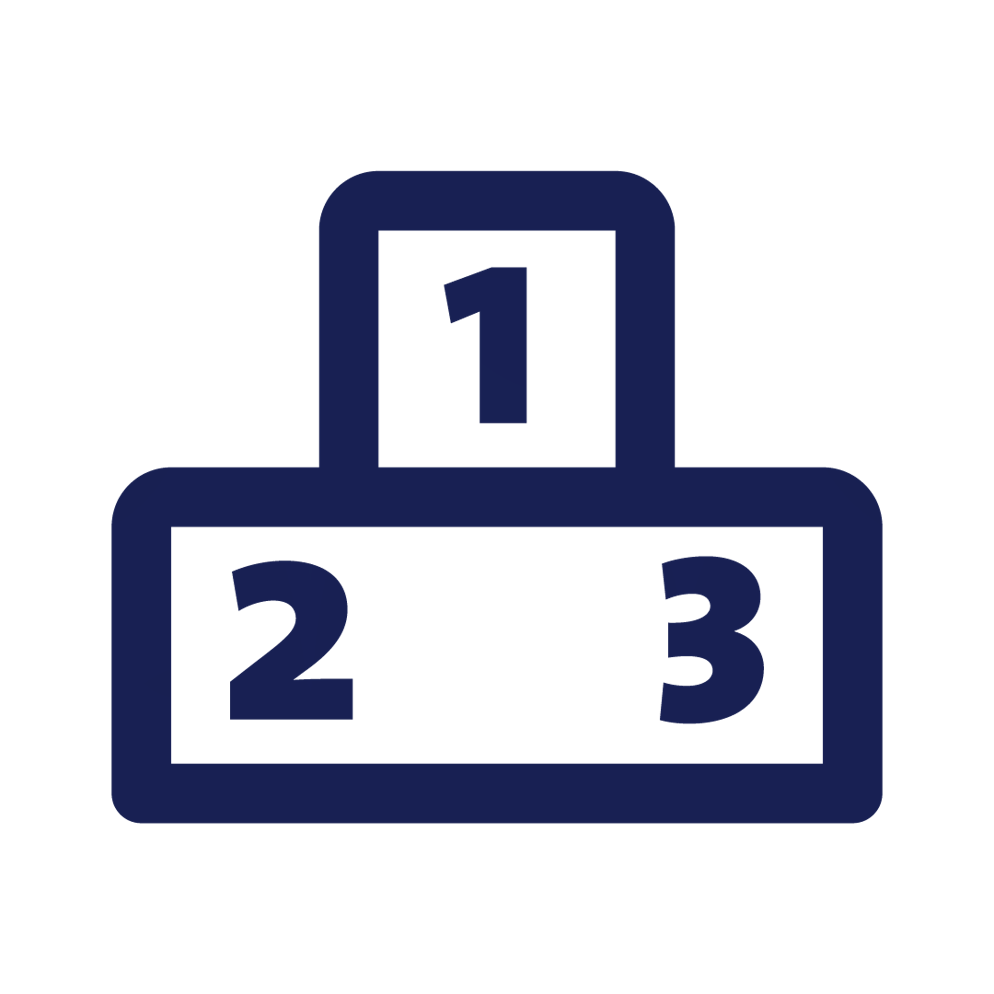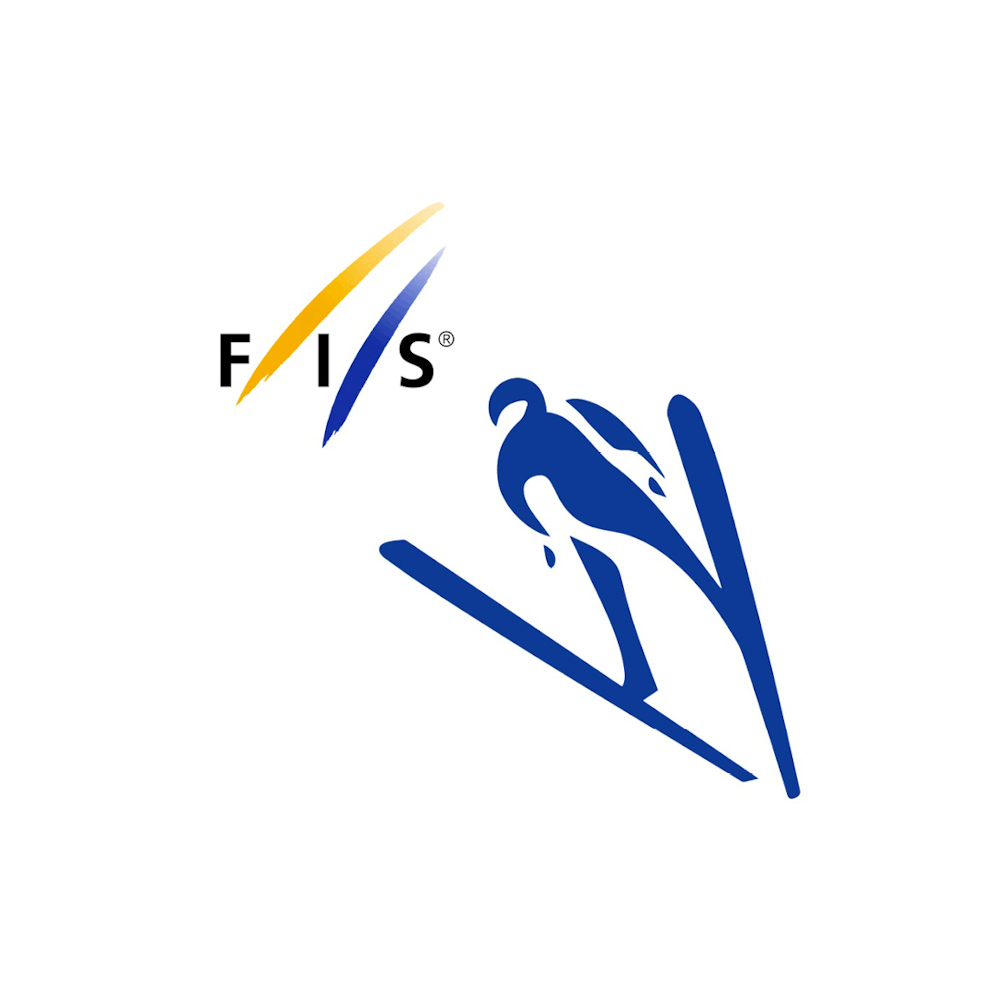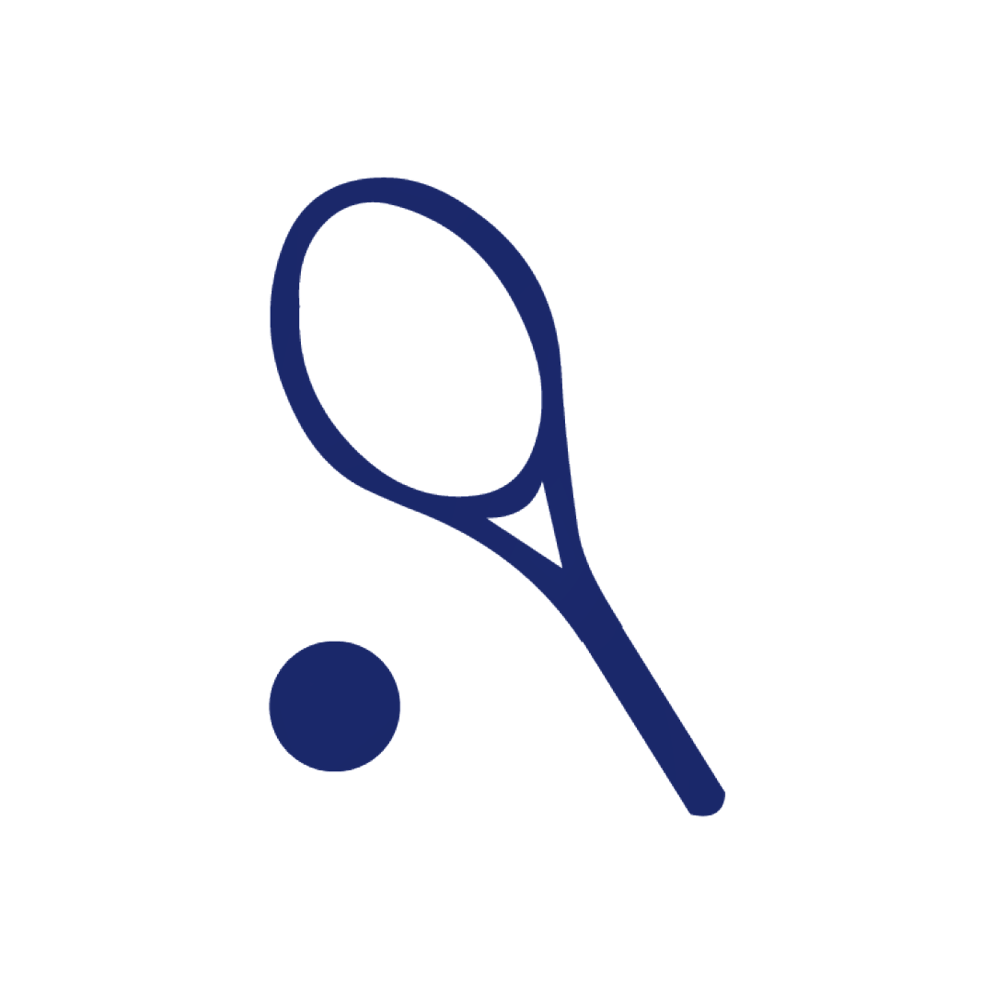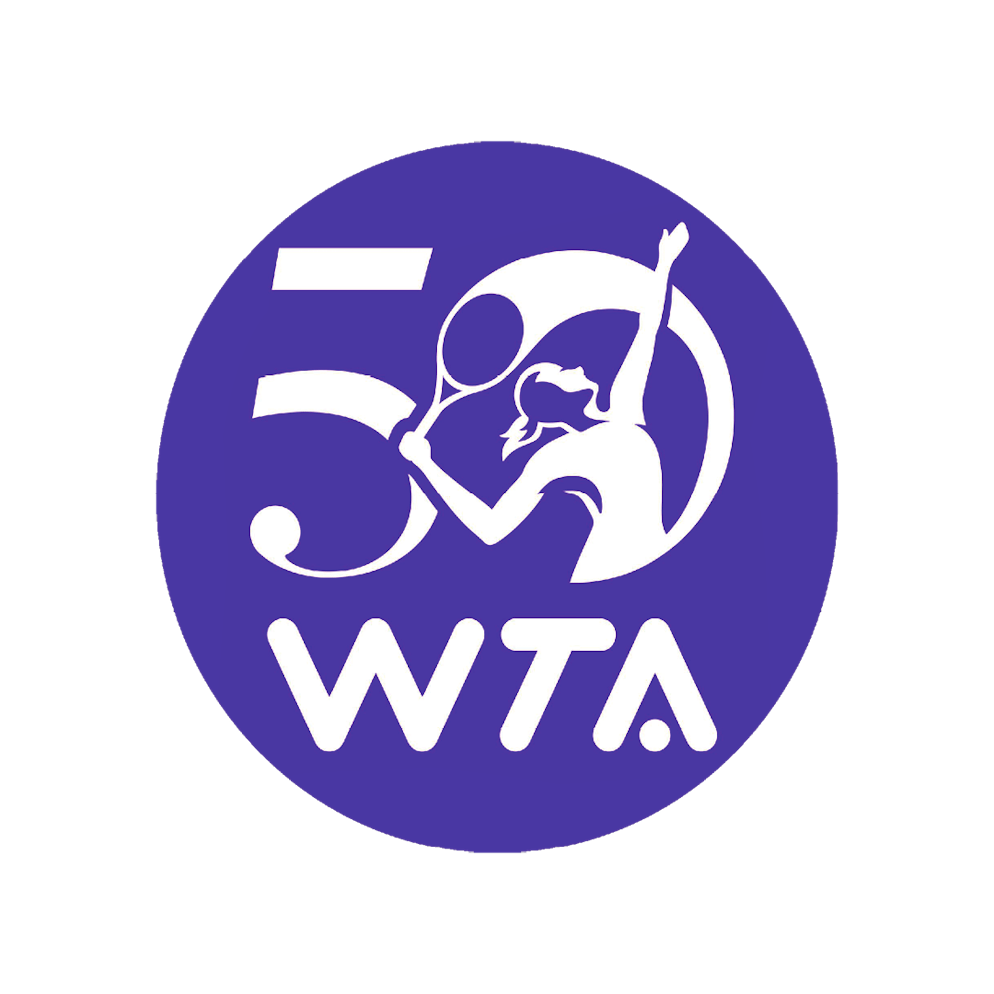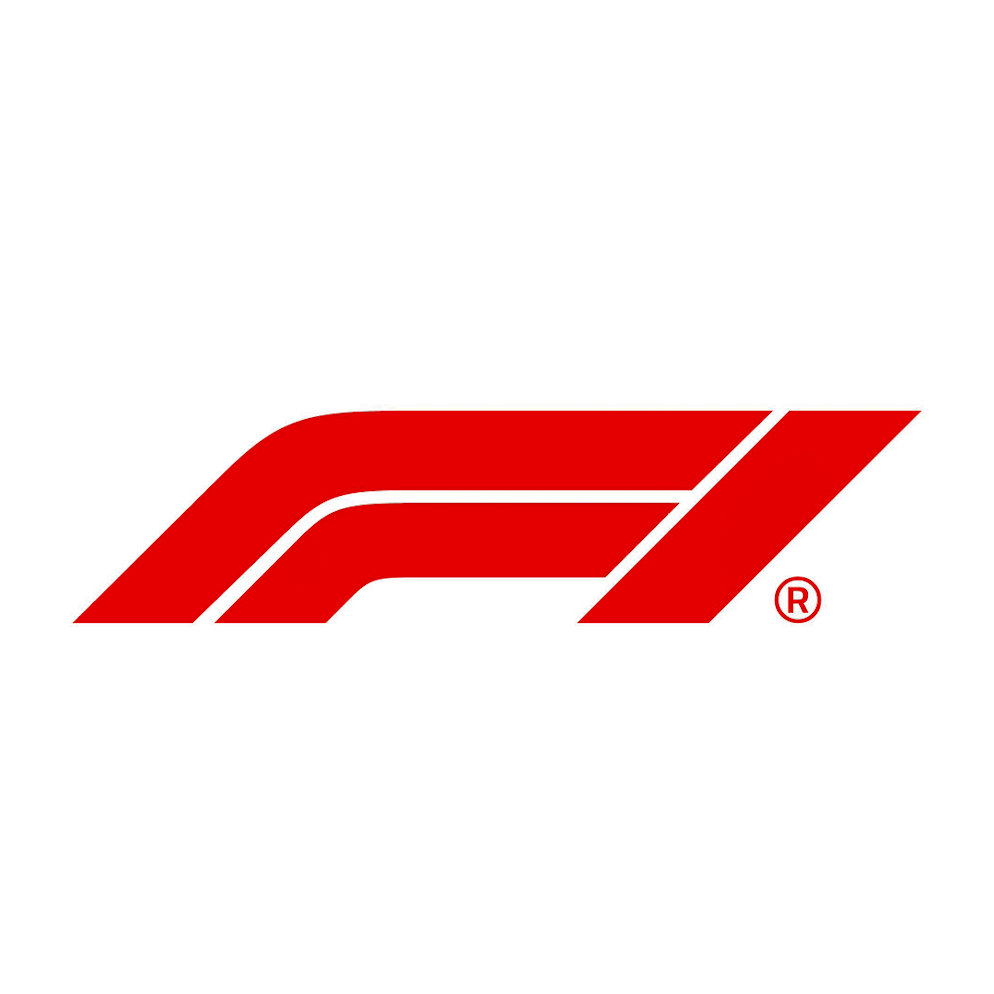Übersicht
Live Fussball
Ligen
Übersicht
Live Wintersport
Resultate und Wertungen FIS
Resultate und Wertungen IBU
Übersicht
Live Eishockey
Resultate und Tabelle
Übersicht
Live Tennis
Turniere
Resultate
Übersicht
Live Motorsport
Rennen und Wertungen
Dienste
blue news – social media
Swisscom
- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Ski
- Wintersport
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
TV-Tipp Fast wie bei Jules Verne: Abtauchen zu einzigartigen Kreaturen
tsch
23.9.2018

Wer hätte gedacht, dass eine vermeintlich unwirtliche Gegend wie die Antarktis und ihre Gewässer eine derart grosse Artenvielfalt beheimaten?
Bild: ZDF/NHK

Seltene Aufnahme: Ein Scheibenbauchfisch aus dem Marianengraben hält mit 8178 Metern den Tiefenweltrekord bei den Fischen. Wie das möglich ist, erklärt die neue Folge von «Terra X».
Bild: ZDF / Joan Myers

Bizarre Wesen leben selbst in den tiefsten Tiefen der Ozeane.
Bild: ZDF / Peter Marriott

Ein grosses Abenteuer à la Jules Verne - nur in echt: Die Alucia befindet sich auf Forschungsreise in den antarktischen Gewässern.
Bild: ZDF/NHK

Das Tauchboot «Nadir» operiert in Tiefen von 1000 Metern.
Bild: ZDF / NHK

Der belgische Forscher Dr. Claude De Broyer kennt sich mit den Vertretern der antarktischen Fauna bestens aus und gewährt spannende Einblicke in das Leben der mitunter bizarren Tiere.
Bild: ZDF / NHK

Tiefen von mehr als 7000 Metern sind nur mit Spezialgerät erreichbar. Es muss einem enormen Wasserdruck standhalten.
Bild: ZDF / NHK

Teures und eigens entwickeltes Equipment finden sich an Bord der «Nadir».
Bild: ZDF / NHK

Wer hätte gedacht, dass eine vermeintlich unwirtliche Gegend wie die Antarktis und ihre Gewässer eine derart grosse Artenvielfalt beheimaten?
Bild: ZDF/NHK

Seltene Aufnahme: Ein Scheibenbauchfisch aus dem Marianengraben hält mit 8178 Metern den Tiefenweltrekord bei den Fischen. Wie das möglich ist, erklärt die neue Folge von «Terra X».
Bild: ZDF / Joan Myers

Bizarre Wesen leben selbst in den tiefsten Tiefen der Ozeane.
Bild: ZDF / Peter Marriott

Ein grosses Abenteuer à la Jules Verne - nur in echt: Die Alucia befindet sich auf Forschungsreise in den antarktischen Gewässern.
Bild: ZDF/NHK

Das Tauchboot «Nadir» operiert in Tiefen von 1000 Metern.
Bild: ZDF / NHK

Der belgische Forscher Dr. Claude De Broyer kennt sich mit den Vertretern der antarktischen Fauna bestens aus und gewährt spannende Einblicke in das Leben der mitunter bizarren Tiere.
Bild: ZDF / NHK

Tiefen von mehr als 7000 Metern sind nur mit Spezialgerät erreichbar. Es muss einem enormen Wasserdruck standhalten.
Bild: ZDF / NHK

Teures und eigens entwickeltes Equipment finden sich an Bord der «Nadir».
Bild: ZDF / NHK
Erstmals zu sehende Aufnahmen von den tiefsten Tiefen der Meere zeigen, dass Leben selbst unter extremsten Bedingungen möglich ist.
In den pazifischen Gewässern im Marianengraben liegen mit knapp 11'000 Metern unter dem Meeresspiegel die tiefsten Stellen des Planeten. Erst drei Menschen sind zu ihnen vorgedrungen. Nach dem Schweizer Jacques Piccard und dem US-Amerikaner Don Walsh war es auch der kanadische «Titanic»-Regisseur James Cameron, der 2012 den tiefsten Punkt der Weltmeere erreichte. Zum Vergleich: Auf den 384'000 Kilometer weit entfernten Mond haben es schon zwölf Menschen geschafft. Von Bord des Forschungsschiffes «Alucia» gingen zuletzt zwei weitere Expeditionen bis ganz hinab in den Marianengraben und in die Tiefsee vor Antarktika. Teams der ZDF-Reihe «Terra X» konnten sie begleiten. Sie liefern nun spektakuläre Bilder frei Haus.
Weltrekord in tiefster Tiefe
Das Tauchboot «Nadir» operiert rund einen Kilometer unter dem Meeresspiegel. Teilweise erreichten die Forscher aber Tiefen von rund 7000 Metern. Die technischen Herausforderungen waren enorm. Unter anderem musste das Kamera-Equipment auf einer mechanischen Tiefsee-Plattform, einem sogenannten Lander, dem gigantischen Wasserdruck von mehr als einer Tonne auf der Fläche eines Daumennagels standhalten. Unter diesen Bedingungen scheint Leben unmöglich.
Umso überraschender ist, welche Wunder nun erstmals gezeigte Bilder festhalten konnten. Zu sehen sind Aufnahmen von unerwarteter Bildschärfe - aus bis dato kaum erforschten Meerestiefen. Gezeigt werden Fische, Muscheln, Würmer und am tiefsten Punkt der Erde auch Seegurken. Sogar ein Weltrekord wurde in der tiefsten Tiefe voller Leben eingefangen: Ein Scheibenbauchfisch aus dem Marianengraben hält mit 8178 Metern den Tauchweltrekord bei den Fischen.
Überwältigend sind nicht nur die Tiefen-Dimensionen, sondern auch das Alter und die Grösse der entdeckten Tiere. In vielen Fällen hatten die Forscherteams keine derart riesigen und uralten Meeresbewohner erwartet. Fast fühlt man sich an Jules Vernes «20'000 Meilen unter dem Meer» erinnert, wenn man Aufnahmen gigantischer Schwamm-Wälder, majestätischer Kalmare oder kolossaler Wale zu Gesicht bekommt. Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man sich gerade nicht an Bord der Nautilus befindet, sondern realen dokumentarischen Szenen aus der Tierwelt beiwohnt.
Einfluss des Klimawandels
Inmitten dieser fremdartigen Unterwasserwelten sind den Machern etliche faszinierende Bilder einer mitunter höchst bizarren Fauna gelungen. Doch selbstverständlich beschäftigt sich die neue Folge von «Terra X» nicht nur mit der ungeahnt-spektakulären zoologischen Vielfalt im Marianengraben und vor dem antarktischen Kontinent. Auch die Resultate des Klimawandels finden Eingang in die neue Episode des Dokuformats. So führt die Erderwärmung zum Schmelzen und Wegbrechen riesiger Eisgiganten - und verändert so den natürlichen Lebensraum der Meeresbewohner. Wie mag ihre Zukunft wohl aussehen?
Die neuste Folge von «Terra X» läuft am Sonntag, 23. September, um 19.30 Uhr im ZDF. Mit Swisscom TV Replay können Sie die Sendung bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung anschauen.

Keine Sorge! Diesem bissigen Kameraden können Sie beim nächsten Schnorchelurlaub unmöglich begegnen. Fangzahnfische leben in einer Meerestiefe, in die normalerweise nicht mal ein Kamerateam gelangt.
Bild: WDR / BBC NHU

Für die Dreharbeiten in der Tiefsee haben die Teams über 1000 Stunden in Tauchbooten unter Wasser verbracht. Entstanden sind messerscharfe Bilder von Landschaften und Verhaltensweisen, die noch niemals zuvor zu sehen waren.
Bild: WDR / BBC NHU

Begegnet sind den Filmemachern etwa Schafskopf-Lippfische. Die Männchen erkennt man daran, dass sie deutlich grösser sind als die Weibchen. Verblüffend: Werden die Weibchen gross und alt genug, können sie zu Männchen werden.
Bild: WDR / BBC NHU

Überall sonst sind sie sich spinnefeind. Doch vor Neuseeland bilden Grosse Tümmler und Kleine Schwertwale Gemeinschaften.
Bild: WDR / BBC NHU

Einige Grosse Tümmler sind dafür bekannt, sich mit der Schleimschicht von buschartigen Hornkorallen «einzureiben». Die Wirkung ist vergleichbar mit Antibiotika.
Bild: WDR / BBC NHU

In Teil zwei geht es in die «leuchtende Tiefsee» (Mo., 26.02., 20.15 Uhr, ARD). Das ist angesichts dieser Korallen aus 6000 Meter Tiefe nicht zu viel versprochen.
Bild: WDR / BBC NHU

Der Pfannkuchentintenfisch lebt in der kalifornischen Tiefsee. Hat man ihn mal aufgespürt, ist er nicht zu übersehen.
Bild: WDR / BBC NHU

Einsiedlerkrabben haben superscharfe Fangscheren. Die brauchen sie, um an das Fleisch von Riesenmuscheln zu kommen.
Bild: WDR / BBC NHU

Akuter Pulsanstieg an Bord des Tauchboots «Lula». Aber Entwarnung: Grosse Haie können aufgrund ihres Stoffwechsels in der Tiefsee auch mal ein ganzes Jahr ohne Futter aushalten.
Bild: WDR / BBC NHU

Die «Faszination Korallenriff» wird im dritten Teil der Doku-Reihe beschworen. Korallenriffe beherbergen ein Viertel aller bekannten Meerestierarten. Und sie schauen umwerfend aus ...
Bild: WDR / BBC NHU

Der Rotfeuerfisch macht Jagd auf kleine Fische. Er schleicht sich gut getarnt an - und saugt sie ins Maul.
Bild: WDR / BBC NHU

Anemonenfische gehören zu den friedliebenden Korallenriff-Bewohnern.
Bild: WDR / BBC NHU

Der Breitarm-Sepia-Tintenfisch vermag es, seine Beute durch rhythmisches Zucken in eine Art Trance zu versetzen. Die armen Krabben!
Bild: WDR / BBC NHU

Dabei müssen die Zackenbarsche acht geben, dass sie nicht selbst zur Beute werden. Riff-Haie machen Jagd auf sie.
Bild: WDR / BBC NHU

Der Riesenborstenwurm oder Bobbit ist ein fleischfressender Verwandter der Regenwürmer. Er tötet mit Gift.
Bild: WDR / BBC NHU

Vor den Folgen des Klimawandels wird gewarnt! Steigen die durchschnittlichen Wassertemperaturen nur einige Wochen um ein bis zwei Grad an, verlieren Korallen ihre Farbe und sterben ab. Dieses Phänomen ist unter dem Namen Korallenbleiche bekannt.
Bild: WDR / BBC NHU

Die giftige Portugiesische Galeere ist ein Zusammenschluss Tausender von Nesseltierpolypen. «Auf hoher See» heisst es im vierten Film der Doku-Reihe (Mo., 12.03., 20.15 Uhr).
Bild: WDR / BBC NHU

Schon imposanter als das, was einem an der Ostsee gegen die Badehose klatscht: Schirmquallen lassen sich von den Strömungen treiben, können aber auch aktiv schwimmen.
Bild: WDR / BBC NHU

Ein Stück Treibholz bietet diesen Fischen Schutz und Deckung im offenen Meer.
Bild: WDR / BBC NHU

Pottwal-Weibchen organisieren sich mit Artgenossinnen zur Nachwuchsbetreuung. Wie fortschrittlich! Man spricht tatsächlich von «Kindergärten».
Bild: WDR / BBC NHU

In Folge fünf entführt die Doku in den «Unterwasserdschungel» (Mo., 19.03., 20.15 Uhr, ARD). Der ist nicht weniger farbenfroh als der an Land. Tangwedel wirken zumindest auf dieser Aufnahme übernatürlich schön.
Bild: WDR / BBC NHU

Im Dschungel kämpft jeder für sich allein - und für die Freiheit! Der Garibaldi-Fisch hat seinen Namen von einem italienischen Freiheitskämpfer und ist dafür bekannt, sein Territorium energisch zu verteidigen.
Bild: WDR / BBC NHU

Sieht aus wie in der Unterwasser-Blumenhandlung. Aber Purpur-Seeigel in Massen können zu einem ernsten Problem werden. Sie fressen sich durch die Tangstengel und trennen dadurch die Wedel ab. Ganze Tangwälder driften dann haltlos davon.
Bild: WDR / BBC NHU

Gänzlich ungeniert dokumentierte die Kamera auch manchen Paarungs-Akt unter Wasser. Hier finden zwei Riesensepien, eine Tintenfischart, zusammen.
Bild: WDR / BBC NHU

So viele Seespinnen auf einem Haufen mögen einem Taucher einen Schrecken einjagen. Tatsächlich sind sie frisch gehäutet über Tage schutzlos.
Bild: WDR / BBC NHU

Mangrovenwälder sind ihr bevorzugtes Jagdrevier: Die Männchen der Speer-Fangschreckenkrebse können bis zu 40 Zentimeter lang werden.
Bild: WDR / BBC NHU

Dieses Foto ist eine kleine Sensation, denn ein solches Verhalten wurde zuvor nie gefilmt. Ein Tintenfisch versteckt sich vor einem Pyjama-Hai. Er legt sich eine Rüstung aus Muschelschalen an.
Bild: WDR / BBC NHU

Im sechsten und letzten Doku-Teil geht es in die «Extremwelt Küste» (Mo, 26.03., 20.15 Uhr, ARD). Mit dabei: die Rote Klippenkrabbe in Erwartung der Flut.
Bild: WDR / BBC NHU

Seesterne reagieren mithilfe von Lichtsinneszellen an ihren Armen als Erste auf das Licht der Frühlingssonne. Es ist für sie das Signal zum Laichen.
Bild: WDR / BBC NHU

Vor diesem schillernd-schönen Gewächs wird auch gewarnt. Seeanemonen verschlingen alles, was in die Reichweite ihrer Fangarme kommt.
Bild: WDR / BBC NHU

Ein Evergreen unter den monströsen Erscheinungen ist das Ungeheuer von Loch Ness (hier auf einem frühen Foto aus den 1930er Jahren) in Schottland. Angeblich wurde es erstmals im 6. Jahrhundert erwähnt, ist heute weltberühmt und wird mit gewisser Regelmässigkeit gesichtet - zuletzt sogar in England! Leider haben sich bis jetzt fast alle Bilder als mehr oder weniger gut gemachte Fälschungen erwiesen. In Zeiten der Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung wird Nessie, wie das Ungeheuer auch liebevoll genannt wird, jedenfalls mit grosser Sicherheit noch häufiger auftauchen.
Bild: Keystone

Der Kopf der kleinen Mumie aus der Wüste Atacama in Chile erinnert an typische Vorstellungen von Ausserirdischen. Weitere Funde von mysteriösen Wesen und Kreaturen zeigen wir in dieser Bilderstrecke.
Bild: Bhattacharya S et al./Cold Spring Harbor Laboratory/dpa

Puppe des sogenannten Roswell-Aliens im International Ufo Museum in Roswell, New Mexico: Das Wesen aus dem All soll 1947 in der Wüste New Mexicos mit einem Ufo geborgen worden sein und wurde anschliessend angeblich wissenschaftlich untersucht. Bei der fliegenden Untertasse, so meint ein offizieller Bericht, soll es sich jedoch lediglich um ein militärisches Fluggerät gehandelt haben, das getestet wurde. Der Alien selbst erlangte erst mit einem Film über die Ereignisse aus dem Jahr 1995 Berühmtheit und wurde dafür wohl lediglich aus Latex gefertigt - eine Existenz zuvor ist nicht verbürgt.
Bild: Getty Images

Ein TV-Bericht aus dem Jahr 1997 vermutet als Ursache für die Legende des Roswell-Aliens, ziemlich schlüssig, einen Dummy wie diesen hier, der über dem Gelände bei einem Experiment mit einem Fallschirm aus grosser Höhe abgeworfen wurde.
Bild: Keystone

Dieser angebliche Yeti-Skalp im Kloster von Pangboche im nepalesischen Khumbu - hier auf einer Aufnahme aus den 1970er Jahren - ist inzwischen aus ungeklärten Umständen verschwunden. (Archiv)
Bild: Getty Images

US-Forscher nahmen nun DNA-Proben von angeblichen Yeti-Überbleibseln unter die Lupe, darunter auch ein Stück behaarter Haut von einer Hand oder Pranke, die in einem Kloster aufbewahrt worden war und ein Stück Oberschenkelknochen, das in einer Höhle auf dem Tibetanischen Hochplateau in 4500 Metern Höhe gefunden wurde.
Bild: Getty Images

Das Geheimnis der weissen Hirsche in Hessen ist gelöst - es handelt sich um Rotwild mit einer besonderen Erbanlage. «Wir haben es geschafft, das Gen zu finden, und können genau sagen, wie hoch der Prozentsatz der Träger ist», erklärten Wissenschaftler von der Universität Giessen.
Bild: dpa

Die Tiere sind Gegenstand von Aberglauben: Wer einen weissen Hirsch tötet, stirbt innerhalb eines Jahres - das besagt das Jägerlatein. Im Bild: Weisse Rothirsche (Cervus elaphus) stehen am 24. Mai 2017 im Tierpark Sababurg im Reinhardswald (Deutschland).
Bild: dpa

Ein sehr seltsames Objekt lag im Dezember 2016 plötzlich am Strand beim neuseeländischen Auckland - das sogenannte «Muriwai Monster».
Bild: Getty Images

Das Ding war nicht nur ellenlang, sondern stank auch bestialisch. Melissa Doubleday, die den Hype um das Objekt auf Facebook mit ihrer Frage «Bin neugierig. Weiss jemand, was das ist?» losgetreten hatte, berichtete später: «Alles darauf ist inzwischen gestorben und es stinkt wirklich übel.»
Bild: Getty Images

Auf dem mysteriösen Fund klebten unzählige Entenmuscheln, dazwischen tummelten sich Heerscharen von Würmern. Was sich unter der krabbelnden Oberfläche verbarg, darüber wurde in einer lokalen Facebook-Gruppe fleissig gerätselt. Manche dachten an den Kadaver eines Wals, andere glaubten, es könne ein antikes Maori-Kanu sein. Besonders kreative Beiträger glaubten an eine Zeitkapsel von Aliens oder an einen «Strand-Weihnachtsbaum».
Bild: Getty Images

Jemand aus der Facebook-Gruppe wollte es dann doch genauer wissen und fragte bei den Experten der Neuseeländischen Meeresforschungsgesellschaft nach.
Bild: Getty Images

Dort hatte man dann doch eine etwas weniger aufregende Erklärung auf Lager. Die Experten meinten, es handle sich höchstwahrscheinlich um ein riesiges und mit Entenmuscheln übersätes Treibholz. Der halb verrottete Baum sei mitsamt seinen tierischen Bewohnern wahrscheinlich durch das starke Erdbeben im November in Bewegung gekommen und an den Strand gespült worden.
Bild: Getty Images

Als sichere Fälschung gilt der sogenannte Cardiff Giant: Der mysteriöse Riese wurde 1869 im Dorf Cardiff bei New York ausgegraben. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine menschengemachte Statue handelte, mit der der Tabakpflanzer George Hull den Pfarrer des Ortes veralbern wollte.
Bild: Getty Images

Die sogenannten Cottingley Fairies (deutsch: Cottingley-Feen) wurden 1917 auf fünf Fotos der jungen Cousinen Frances Griffiths und Elsie Wright im englischen Cottingley dokumentiert. Die Fotos stellten sich später als Fälschungen heraus - die zeichnerisch begabte Elsie hatte sie aus einem Buch auf Karton abgezeichnet, ausgeschnitten, und vor sich in Szene gesetzt. Die unechten Feen gelten bis heute als einer der grössten Hoaxes des 20. Jahrhunderts.
Bild: Getty Images